
Informatik Wenn Maschinen wirtschaften
Intelligente, vernetzte und autonom handelnde Maschinen werden unsere Zukunft revolutionieren. Ganze Fabriken könnten sich vollkommen selbst organisieren – innerhalb einer eigenen Ökonomie
Wir schreiben das Jahr 2045: Kaum jemand besitzt noch ein eigenes Auto. Stattdessen nutzen die Menschen ein reichhaltiges Angebot von Fahrzeugen, die niemandem gehören – weder einer Person oder einer Firma noch dem Staat. Sie gehören sich selbst und erwirtschaften selber ihren „Lebensunterhalt“ – die nächste Batterieladung, Reparaturen oder Parkgebühren
Wer von A nach B möchte, stellt per Smartphone-App den Kontakt mit den Autos her und verhandelt Parameter wie Abholort, Fahrtziel oder Beförderungsbedingungen. Das Besondere ist: Diese Autos agieren als autonome Servicedienstleister innerhalb eines neuen „Ökosystems“ intelligenter und hochgradig vernetzter Maschinen. Die technische Machbarkeit eines solchen Systems ist mittlerweile unumstritten, unklar ist allenfalls, wie lange dessen Verwirklichung noch auf sich warten lässt – 10 Jahre, 15 Jahre oder doch länger?
Mit dem Aufkommen intelligenter und autonom handelnder Maschinen eröffnen sich neue ökonomische Dimensionen, die auch Transaktionen und Kollaborationen zwischen Mensch und Maschine, zwischen Maschinen untereinander und auch zwischen Maschinen und Infrastrukturkomponenten wie Ladestationen oder Verkehrsampeln möglich machen. Setzt sich diese Idee durch, wäre ein ganz anderes Wirtschaftssystem die Folge. Es würde alle Transaktionen, Interaktionen und Kollaborationen von autonom handelnden Maschinen mit anderen Maschinen, Menschen oder Infrastrukturkomponenten umfassen. Unser Name dafür: die M2X-Ökonomie, von „machine to everything“.
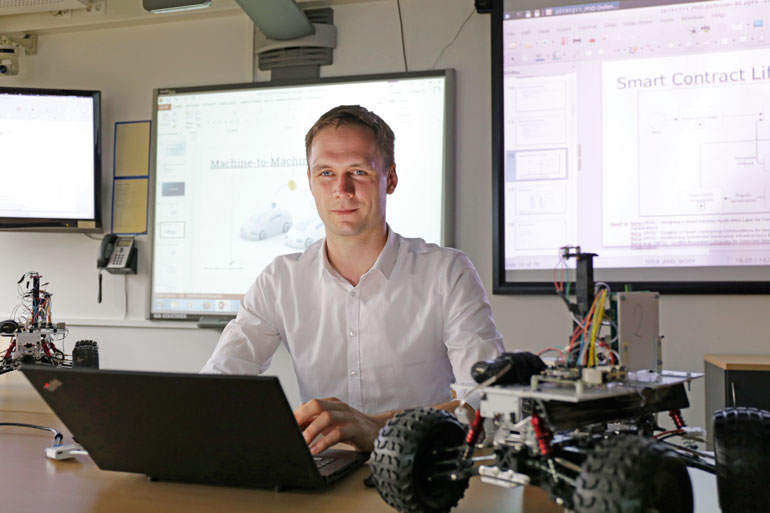
Doch wie lässt sich das in der Praxis umsetzen? In einem ersten Schritt entwickelten wir unter Verwendung von Forschungsergebnissen des Teams um Alex Norta von der Tallinn University of Technology einen sogenannten Prozesslebenszyklus – und zwar für das Beispiel der Nutzung der Fahrzeuge. Damit können wir nicht nur die Interaktionen von Mensch und Maschine abbilden, sondern auch die Batterieladevorgänge, automatische Abrechnungen von Maut- und Parkplatzgebühren und vieles mehr realisieren.
In der Praxis hat die Nutzerin oder der Nutzer zunächst die Wahl zwischen verschiedenen Verträgen – je nachdem, ob er ein Elektromofa, einen Pkw oder einen Lkw buchen möchte. Im nächsten Schritt werden die persönlichen Daten abgeglichen sowie Datum, Start- und Zielort der Fahrt definiert. Wie viele Leute fahren mit? Habe ich bestimmte Ansprüche an den Komfort? Und so weiter. Am Ende erfährt die Nutzerin oder der Nutzer den Preis. Nach-dem alle vertraglichen Formalitäten auf digitalem Wege erledigt sind, kann es losgehen. Die Nutzerin oder der Nutzer und das selbstfahrende Auto treffen sich am vereinbarten Ort.
Dieses System ist natürlich flexibel und macht eine Vielzahl von Vorschlägen. So kann die Kundin oder der Kunde auch von bereits geplanten Fahrten profitieren – beispielsweise wenn er umziehen will und ein Möbelwagen, der von A nach B fährt, noch Platz hat. Auch die gute alte Fahrgemeinschaft kann so wieder populär werden.
Wird das Fahrzeug am Ende am Zielort wieder abgestellt, erfolgt die automatische Zahlung – so, wie es ja auch heute schon im Car Sharing gang und gäbe ist. Vertragsverletzungen werden automatisch geprüft und haben je nach Schwere unterschiedliche Konsequenzen. Ein Beispiel: Wenn ein Nutzer nicht an den vereinbarten Treffpunkt kommt, ist das schwerwiegender, als wenn ein Fahrzeug nicht ganz sauber ist.
Prinzipiell kann ein solcher Prozesslebenszyklus – also der Zeitraum vom ersten bis zum letzten Kontakt – natürlich viel mehr. Selbst ganze Fabriken könnten sich auf diese Weise selbst verwalten, Angebot und Nachfrage bewerten, Rohstoffe einkaufen, verarbeiten und die Produkte am Ende an die Kundinnen und Kunden ausliefern. Der Mensch wäre bei alldem unnötig. All diese Prozesse basieren letztlich auf den entsprechenden elektronischen Vertragsmustern.
Im nächsten Schritt überlegten wir uns, wie ein solches Ökosystem beschaffen sein muss. Damit ist die komplexe Infrastruktur gemeint, in der all die Interaktionen und Kollaborationen reibungslos funktionieren müssen. Das stellt uns in der Tat vor große Herausforderungen, denn viele technologiebasierte Ökosysteme – besonders in der IT-Welt – setzen heutzutage stark auf sogenannte Lock-in-Effekte. Sie zwingen Nutzerinnen und Nutzer dazu, im eigenen Ökosystem zu bleiben, und machen ihnen den Wechsel zur Konkurrenz möglichst schwer. Besitzerinnen und Besitzer eines iPhones, die sich ein auf Android basierendes Smartphone kaufen wollen, können davon ein Lied singen.
Ein M2X-Ökosystem, in dem es eine Vielzahl verschiedener Hersteller und Serviceanbieter mit individuellen technischen Systemen gibt, ist also undenkbar. Wir benötigen vielmehr ein Ökosystem, das auf gemeinsamen Standards beruht und für alle Beteiligten gleichermaßen offen ist. Das größte Problem dabei dürften die vielfältigen regulatorischen Hürden sein, die überdies von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Dass diese Hürden einmal fallen werden, klingt zunächst utopisch – zumal ein solches Ökosystem ja konkurrierende Unternehmen zur Kooperation zwingen würde. Allerdings gibt es auch dafür funktionierende Beispiele – das beste ist das Internet: Es beruht auf globalen Standards, die Interoperabilität und Kompatibilität von Hardware und Diensten sicherstellen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenEssenzieller Bestandteil sämtlicher wirtschaftlicher Beziehungen ist – und wird auch in einer zukünftigen M2X-Welt sein – das Vertrauen. Das erscheint trivial, ist aber ziemlich kompliziert. Denn es geht ja nicht um das menschliche Gefühl des Vertrauens, sondern um Sicherheit. So müssen beispielsweise national unterschiedliche Rechtssysteme kompatibel miteinander verknüpft werden. Letztlich brauchen alle „Maschinen“ im System eine Art digitale Identität.
Unser M2X-Ökosystem kommt ohne eine zentrale „staatliche“ Verwaltung aus. Stattdessen verwaltet jede Nutzerin und jeder Nutzer, egal ob Mensch oder Maschine, ihre oder seine Identität unabhängig und selbstbestimmt. Selbstverwaltete Identitäten kommen ohne die bisher übliche Zwangsanbindung an Accounts von IT-Dienstleistern aus und erlauben ihren Besitzern, sich mit kryptografisch abgesicherten Dokumenten gegenüber beliebigen anderen „Objekten“ zu authentifizieren.
Ein solches Ökosystem würde Wirtschaft und Gesellschaft tief greifend verändern. In vielen Bereichen wird die Automatisierung durch Drohnen, Roboter und andere Maschinen sicherlich manche menschliche Arbeitskraft ersetzen. Zugleich werden aber auch neue Arbeitsplätze geschaffen – womöglich aber nicht in gleicher Anzahl und Qualifikation.
Angesichts wachsender Probleme etwa infolge des Klimawandels erlaubt aber gerade ein M2X-Ökosystem autonomer Transportdienstleister eine viel effizientere Nutzung von Ressourcen. So müsste sich dann niemand mehr ein eigenes Auto kaufen, das ja die meiste Zeit ohnehin unnütz auf dem Parkplatz steht und somit eine große Verschwendung an sich darstellt – für seinen Besitzer genauso wie für die Allgemeinheit.
Das Netz der Dinge
Selbstorganisierten Maschinen gehört die Zukunft. Die Basis ist das Internet
So neu ist die Geschichte vernetzter Maschinen ja nicht. Seit Jahrzehnten schon übermitteln Telefone ihre Nummern untereinander, lassen Süßigkeitenautomaten ihre Betreiber wissen, wann sie nachgefüllt werden wollen, oder senden Wetterstationen ihre Daten an die meteorologischen Dienste.
Die Zukunft solcher Technologien ist voller Fantasie – im „Internet der Dinge“ (IoT) ist manches schon verwirklicht. Auch wenn sich das Heim, in dem sich die Lichtverhältnisse der Stimmung seiner Bewohnerinnen und Bewohner anpassen und der Kühlschrank selbsttätig den Biernachschub bestellt, bisher nicht so rasch durchsetzt, wie die Industrie sich das wünschte.
Grundlage dafür ist die Möglichkeit der mobilen Datenübertragung, die wir im Alltag bereits permanent nutzen: Der QR-Code auf einem Plakat lenkt uns zielsicher auf die richtige Website, Fitnessarmbänder übertragen die Joggingrunde an Gleichgesinnte im Internet und vieles andere mehr. In manchen Städten gibt es bereits intelligente Verkehrsampeln, die für Rettungsfahrzeuge automatisch auf Grün schalten.
Es ist zweifelsohne nur eine Frage der Zeit, dass das IoT auch zu strukturellen Veränderungen in der Organisation industrieller Prozesse führt. Schon bald sind weltweit rund 20 Milliarden Geräte im IoT vernetzt. Im Jahr 2018 waren es nicht einmal halb so viele.
All die Haushaltsgeräte, selbstfahrenden Autos und smarten Fitnessarmbänder sammeln natürlich auch Unmengen von teils höchst persönlichen Daten über uns. Zudem ist eine Infrastruktur gegenüber Cyberangriffen umso empfindlicher, je vernetzter sie ist. Es ist fraglich, ob Datenschutz und -sicherheit mit den immer schnelleren Entwicklungen Schritt halten können. Oder ob wir alle uns einfach stillschweigend daran gewöhnen.
— JS

