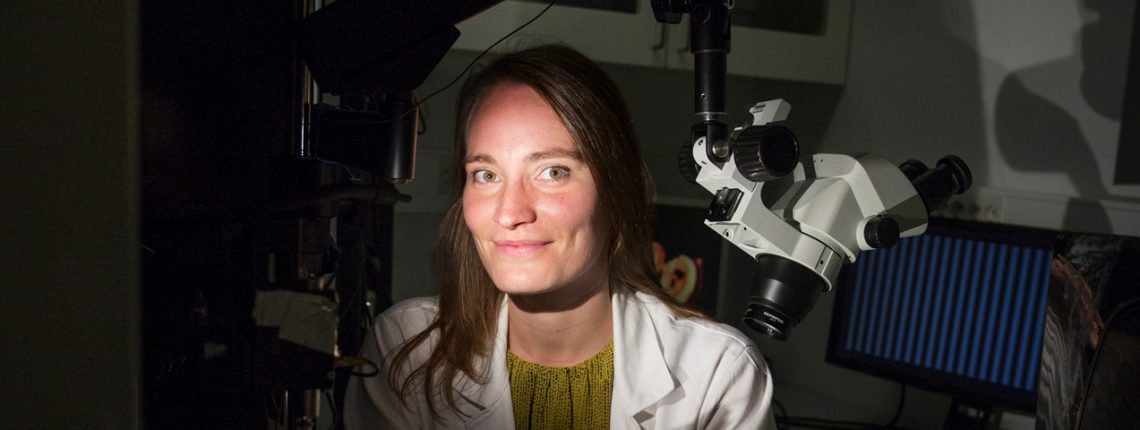
Neurowissenschaften Mit guter Sicht durch die Nacht
Nachts sind alle Katzen grau. Warum? Weil die Lichtempfindlichkeit unseres Auges nicht ausreicht, um im Dunkeln Farben zu sehen. Ein Nachtfalter ist uns da weit voraus. Trotz seines winzigen Gehirns fi ndet er sich im Dunkeln bestens zurecht. Von ihm könnten Ingenieure lernen, wie selbstfahrende Autos nachts ihren Weg finden, beweist Neurowissenschaftlerin Anna Stöckl.
„Wow, das ist ja total spannend!“ möchte natürlich jeder Doktorand gerne hören, wenn er über sein Forschungsthema spricht. Stattdessen höre ich oft: „Aha, und wozu ist das gut?“ Ich habe mich mit der visuellen Informationsverarbeitung im Gehirn von Schwärmern beschäftigt, den nachtaktiven Verwandten der Schmetterlinge.
Wie Kolibris schweben diese flauschigen Falter vor Blüten in der Luft, um mit ihrem Rüssel an den Nektar zu gelangen. Über ihre Flugkünste hinaus beeindrucken sie vor allem durch ihre visuellen Fähigkeiten: Mein Studienobjekt, der Mittlere Weinschwärmer (Deilephila elpenor), war das erste Tier, bei dem nachgewiesen wurde, dass es nachts Farben sehen kann – auch dann, wenn die Welt für uns Menschen längst nur noch in Grautöne getaucht scheint. Der Mittlere Weinschwärmer ist damit ein einzigartiges Objekt, um die Tricks der Nachtsichtspezialisten zu untersuchen.

Warum stellt das nächtliche Sehen eigentlich eine derart große Herausforderung dar? Alle visuellen Systeme, seien es Augen oder Kameras, rekonstruieren ein Abbild der Welt, indem sie Lichtpartikel, sogenannte Photonen, erfassen. An einem sonnigen Tag ist das kein Problem, doch während einer sternenklaren Nacht treffen bis zu einhundert Millionen Mal weniger Photonen am Auge ein. Wenn der Photonenfluss, der am helllichten Tag auf die Fotorezeptoren (die Lichtdetektoren des Auges) trifft, dem Wasserfluss der Niagarafälle entspricht, kann man sich den Fluss im Dunkeln als leichten Nieselregen vorstellen.
Gleichwohl müssen die Fotorezeptoren daraus verlässliche Informationen erzeugen. Nachtaktive Tiere haben daher im Lauf der Evolution spezielle Strategien entwickelt – extra große Linsen etwa oder eine lichtreflektierende Schicht im Augenhintergrund, die zusätzliche Photonen auf die Rezeptoren lenkt. Auch der Weinschwärmer hat sich auf diese Weise der Dunkelheit angepasst – allerdings so gut, dass seine Lichtempfindlichkeit nicht allein mit den bekannten Strategien erklärt werden kann. Die Weinschwärmer, so scheint es, können besser sehen, als es ihre Augen zulassen.
„Des Rätsels Lösung liegt im Gehirn“, ist mein Doktorvater Eric Warrant von der Lund University seit langem überzeugt. Seine Arbeiten zeigen, dass es Insekten theoretisch möglich ist, ihre Lichtempfindlichkeit durch geschickte Verarbeitung der Lichtsignale im Gehirn zusätzlich zu steigern. Obwohl das Hirn eines Schwärmers kleiner ist als ein Reiskorn, konzentrierte ich mich auf eben diese Struktur. Ich wollte herausfinden, ob es tatsächlich über eine spezielle visuelle Signalverarbeitung verfügt – eine Art Nachtsicht-Algorithmus, der seine Lichtempfindlichkeit steigert.
Die Signalverarbeitung erfolgt im Schwärmergehirn wie auch in unserem durch Nervenzellen, die sogenannten Neuronen. Visuelle Neuronen erhalten Informationen über Lichtsignale von den Fotorezeptoren im Auge und verarbeiten sie zu Signalen, die das weitere Verhalten des Schwärmers steuern.
Bei der Suche nach dem Nachtsicht Algorithmus konzentrierte ich mich auf die Neuronen, die für die visuelle Flugsteuerung der Nachtfalter verantwortlich sind. Da der Weinschwärmer auch bei Sternenlicht noch sicher fliegen kann, müssen diese Neuronen besonders lichtempfindlich sein. Auf einem Computerbildschirm präsentierte ich meinen Versuchsfaltern visuelle Reize, deren Intensität ich genau kontrollieren konnte. Mithilfe feinster Glaselektroden, die ich in die Schwärmergehirne einführte, maß ich die winzigen Spannungsänderungen der Neuronen.
Insektengehirne sind einzigartige Vorbilder für die Entwicklung effizienter Steuersysteme – etwa für selbstfahrende Autos.
Dabei zeigte sich, dass die Flugsteuerungs-Neuronen im Gehirn in der Tat noch auf Signale reagierten, die einhundertmal lichtschwächer waren als die schwächsten Signale, auf die die Fotorezeptoren im Auge noch verlässlich reagierten. Eine klare Bestätigung für die Existenz des Nachtsicht-Algorithmus!
Doch wie funktioniert der? Für die Antwort auf diese Frage kehren wir noch einmal zu den Grundlagen des Sehens zurück: Das visuelle System ist bei Dunkelheit umso lichtempfindlicher, je mehr der spärlich eintreffenden Lichtsignale verarbeitet werden können. Grundsätzlich sind zwei Strategien denkbar, um die Anzahl der verarbeiteten Lichtsignale zu erhöhen; um in der Analogie des Niederschlags zu bleiben: Wir können Regen sammeln, indem wir einen Eimer für ein paar Minuten unter den Ablauf eines Dachs stellen oder aber einen anderen über Stunden oder Tage auf eine Wiese. Dabei geht allerdings in dem einen wie dem anderen Fall Auflösung verloren: Wenn wir den Regen in kurzer Zeit von einem Dach auffangen, können wir nicht genau bestimmen, wo der einzelne Tropfen fiel – wir haben also eine geringere räumliche Auflösung. Im Eimer, mit dem wir über Tage Regen sammeln, fehlt uns hingegen die Information, wann genau ein Tropfen niederging.
Auch die Neuronen im Schwärmergehirn nutzen diese Prinzipien für die Verstärkung – oder „Summation“ – von Lichtsignalen, die auf die Fotorezeptoren in ihren Facettenaugen treffen. Diese bestehen aus über zehntausend einzelnen „Ommatidien“, die das wahrgenommene Bild wie einzelne Pixel aufbauen. Der Falter bündelt die Signale von jeweils einigen dutzend dieser Ommatidien, sammelt deren Signale über einen Zeitraum von mehreren hundert Millisekunden – und verstärkt so das vorhandene Lichtsignal um mehr als das Hundertfache. So kann der Weinschwärmer auch bei Sternenlicht sehen, obwohl die einzelnen Fotorezeptoren in seinen Augen keine verlässlichen Signale mehr liefern.

Das geht natürlich auf Kosten der Auflösung. Seine tagaktiven Verwandten jedenfalls können wesentlich feinere Details und schnellere Bewegungen wahrnehmen. Doch dafür sind die tagaktiven Schwärmer eben weniger licht empfindlich – und können nachts nicht mehr fliegen. Und diesen Vorteil nutzt der Weinschwärmer, der nachts mit weniger Konkurrenz auf Nahrungssuche gehen kann und überdies weniger Fressfeinde fürchten muss.
Das eigentlich Erstaunliche dieser Erkenntnis liegt in der Winzigkeit des Falterhirns. Mit Karacho durchs Unterholz zu fliegen, kontrolliert von einem reiskornkleinen, nur ungefähr eine Million Nervenzellen umfassenden Steuerzentrum ist eine grandiose Herausforderung. Zum Vergleich: Die Zahl der Nervenzellen im Schwärmergehirn entspricht etwa der Einwohnerzahl Kölns, während die des menschlichen Gehirns die Weltbevölkerung um mehr als das Zehnfache über trifft.
Insektengehirne sind daher einzigartige Vorbilder für die Entwicklung effizienter Steuersysteme, etwa für autonome Fahr- und Flugzeuge. Auch hier müssen ähnliche Aufgaben mit vergleichsweise begrenzten Rechnerkapazitäten gemeistert werden. Ein Beispiel ist die Entwicklung von Kameras zur Steuerung selbstfahrender Autos, die ja auch nachts sicher funktionieren müssen.
Und so gibt es einen ganz praktischen Nutzen unserer Erkenntnisse: In Zusammenarbeit mit einem Automobilhersteller entwickeln Eric Warrant und Henrik Malm von der Lund University eine Kamerasoftware, die auf den visuellen Verarbeitungsstrategien nachtaktiver Tiere wie dem Weinschwärmer basiert. Diese Software soll dann die Signale herkömmlicher Kameras verarbeiten – und zwar auf ähnliche Weise, wie das winzige Hirn der Schwärmer auch das schwächste Licht noch ausreizt. Es lohnt sich also, nachts die Augen offen zu halten nach jenem Schwärmer und seine spektakulären Flugmanöver zu bestaunen. Wir werden ihm in Zukunft noch viel abschauen können.
Hintergrund
Das Ende der Nacht
Straßenlaternen, Leuchtreklame, Flutlichtanlagen: Die Natur leidet unter Lichtverschmutzung.
So richtig dunkel ist es nur noch im eigenen Keller. Wir machen die Nacht zum Tag, das sieht man sogar aus dem All. So offenbaren die Lichter Berlins (siehe Bild) bis heute, dass die Stadt einst geteilt war: Im Osten stehen nämlich noch viele der alten, eher gelblich leuchtenden Natriumdampflampen, im Westen hingegen die bläulichen Quecksilberdampflampen.
Doch von all dem Licht geht auch eine große Gefahr aus – nämlich für das Leben in der Natur. Zugvögel verlieren über Städten die Orientierung, manche Singvögel beginnen im Frühjahr aufgrund der Beleuchtung so früh mit dem Brutgeschäft, dass sie zu wenig Nahrung für den Nachwuchs finden. Fische meiden hell erleuchtete Brücken und sogar manche Pflanzen reagieren auf zu viel Licht in der Nacht.
Besonders leiden aber die Insekten unter der zunehmenden Lichtverschmutzung. Wenn sie, wie der Mittlere Weinschwärmer, mit so schwachen Lichtquellen wie Mond und Sterne zurechtkommen, sind sie von Straßenlampen völlig überfordert. Magisch angezogen umkreisen sie das Licht – so lange, bis sie erschöpft zugrunde gehen. Eine einzige Leuchte kann pro Nacht einige hundert Insektenleben fordern.
Auch werden sie hier besonders leicht Beute von Fledermäusen, die sich vielerorts gar nicht mehr die Mühe der Jagd in dunkler Natur machen, sondern sich am reich gedeckten Tisch der Parkleuchte bedienen – so wie die vielen Spinnen auch. Kurzum: Wenn wir die Nacht zum Tag machen, stören wir ein komplexes, für unsere Augen meist gar nicht sichtbares ökologisches Gefüge.
Nicht nur in Berlin wird sich das in Zukunft ändern. Denn vielerorts rüsten Städte und Gemeinden ihre alten Leuchten mit modernen LED-Strahlern aus. Und diese sparen nicht nur Energie, sondern wirken auch auf Insekten viel weniger anziehend.
von Joachim Schüring

